Aufsatteln für einen Ritt ins Ungewisse
Ich stehe im Domicil direkt vor der Bühne, neben mir wippt Annika. Der Rauch meiner Zigarette kratzt im Hals und mir ist ein bisschen übel, ich habe gerade erst damit angefangen. Ich rede mir ein, dass niemand merkt, wie ich mit der Zigarette versuche mein fehlendes Selbstbewusstsein zu kaschieren. Als wäre dieser kleine Akt der Selbstzerstörung ein sicherer Anker inmitten meiner nervösen Identitätskrise.
Da steht er also, mit einem Fender-Bass, knapp einen halben Meter über mir, und meine Hormone springen im Dreieck. Die jugendlich-rauen Klänge die da aus den Boxen knallen, verraten mir, dass dieser schlaksige Typ seinen Stimmbruch wohl gerade hinter sich gelassen hat. Heiß.
Annika hatte ein Auge auf den Gitarristen geworfen, und ich kanns verstehen aber meine Aufmerksamkeit bleibt beim Bass. Kein Blick, kein Wort – ich rauche eine nach der anderen und merke mir später im Stillen den Namen seiner Band. Jaques She Rock. Was für ein geniales Wortspiel. Ich flippe innerlich aus. Zu Hause stalke ich die Band sofort auf Myspace und schreibe den Jaques eine Nachricht, kopfüber ins Ungewisse. Bald darauf chatte ich mit diesen Boyband-Sternchen. Björn, du bassspielender Pubertätstraum, ich glaube ich liebe dich.

Es dauert keine zwei Wochen bis ich mich mit seinem Gitarristen treffen und wir uns stattdessen unsterblich ineinander verlieben sollten. Er ist 16, ich 15, es wird eine Beziehung voller dramatischer mehrtägiger Unterbrechungen, die aber insgesamt zweieinhalb Jahre lang Jonas und mein Leben prägen wird. Jede erste Liebe ist mehr als romantisches Drama, sie ist ein Crashkurs in Rollen, Abhängigkeiten und Identität. Solche frühen Beziehungen wirken wie Blaupausen: Sie definieren, wie wir Nähe suchen, wovor wir fliehen und welche Leerstellen wir in anderen füllen wollen. Also Jonas, hier der Satz, den doch alle Männer hören wollen: du hast mich für die Welt verdorben
Dieser Moment im Domicil markiert nicht nur der Anfang einer jugendlichen Liebesgeschichte, sondern auch der Beginn einer Ich-Identität, die sich für viele Jahre als Partnerin von jemandem definieren würde. Ein flexibles Gegenstück, das entlang der Vorlieben und Identitäten seiner Spielgefährten bis heute versucht, erwachsen zu werden.
Schutzschild Beziehung: Die Angst vor dem Alleinsein
Damals schien mir ein Großteil meines Selbstwerts davon abzuhängen, wie ich in den Augen meines Gegenübers wahrgenommen wurde. Ich war jemand, weil ich für jemanden war, eine Partnerin, ein Spiegel, ein Gegenstück. Meine Vorstellungen von Liebe waren untrennbar mit der Vorstellung von Identität verknüpft. Als sei ich erst vollständig, wenn ich im Kontext eines anderen Menschen stand.
Es folgten Beziehungen mit den unterschiedlichsten Menschen, ohne äußeres Schema, aber mit demselben inneren Muster: die Suche in ihnen, was im Innern nicht zu finden war. Ich formte mich entlang ihrer Erwartungen, als wäre ich erst dann jemand, wenn ich für sie jemand sein konnte. Aber wozu?
Während ich das hier Revue passieren lasse, fällt auf: Ich war nie wirklich allein. Nie länger als ein paar Wochen Single. Rückblickend waren monogame Beziehungen für mich oft ein Schutz vor dem Alleinsein, ein Raum, der mir scheinbare Autonomie verlieh. Alleinsein hätte bedeutet, sich den eigenen Unsicherheiten zu stellen und die volle Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Und mein 16- bis 25-jähriges Ich so: pff, nee, lass mal. Wir haben andere Probleme.
Fürsorge ist keine Privatsache
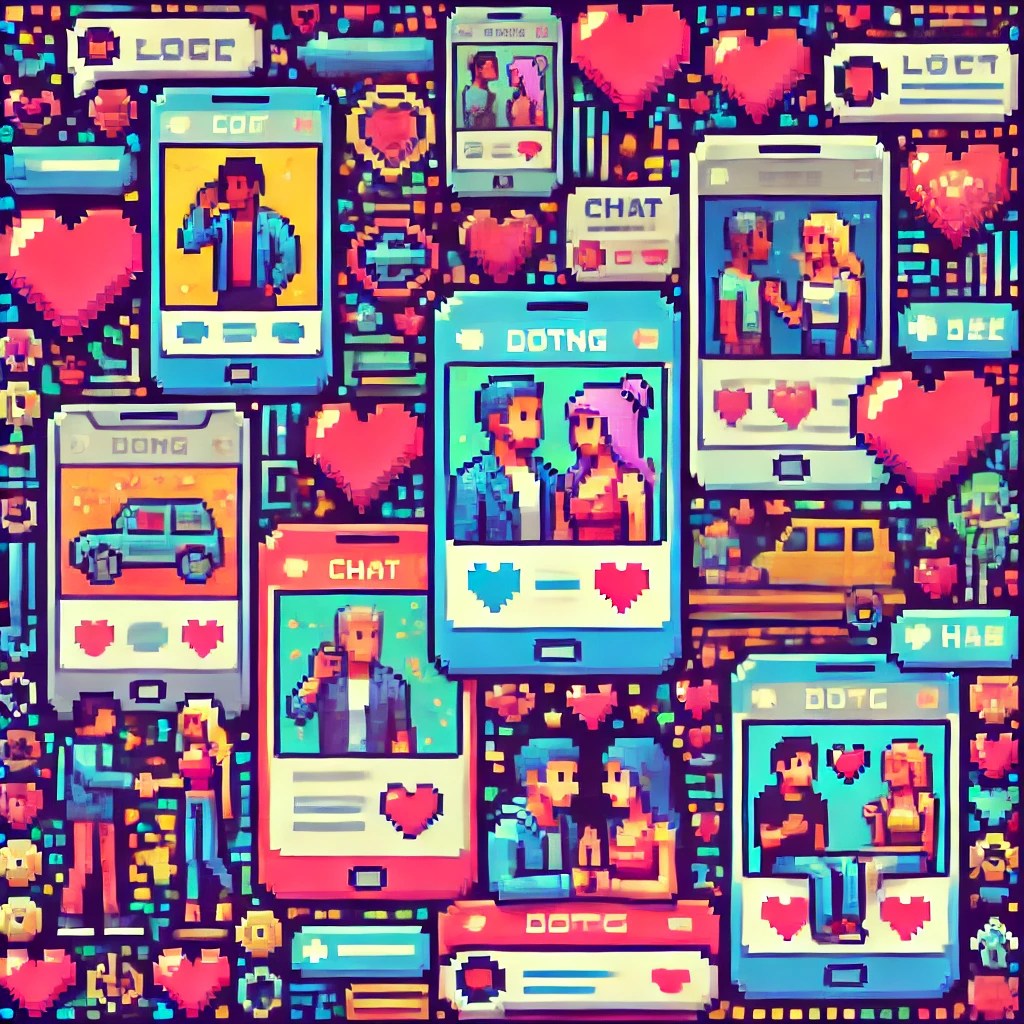
Beziehungen funktionieren eben oft wie ein unsichtbares Sicherheitsnetz, das uns auffängt, wenn wir uns selbst nicht tragen können. Das ist eine Ressource, ein Fürsorgearrangement. Aber es ist eines, das an die Paarbeziehung geknüpft ist. Und genau da liegt der Haken: Wieso sollte Fürsorge exklusiv an romantische Partnerschaften gebunden sein? Wer fängt uns auf, wenn dieses Netz reißt? Hier beginnt die Frage nach Fürsorge, die nicht nur privat verhandelt wird, sondern kollektive Strukturen braucht.
Zwischen Ressource und Falle: Paarbeziehungen als Infrastruktur
Je mehr ich heute als Single darüber nachdenke, desto bewusster wird mir: Beziehungen sind nicht nur privat, sie sind gesellschaftliche Infrastruktur. Sie liefern die Codes, über die wir Wert, Status und Zugehörigkeit aushandeln. Deshalb fühlen sie sich so stabilisierend an. Aber dieselben Mechanismen können auch belasten, weil sie Identitäten fixieren, Erwartungen zementieren und Bewegungsspielräume einschränken.
Und doch: Beziehungen können eine Ressource sein. Wenn wir Intimität und Liebe als Teil gesellschaftlicher Infrastruktur begreifen, wird klar, dass Fürsorge keine reine Privatsache ist. Sie ist eine geteilte Ressource, eine Praxis, die wir gemeinsam gestalten müssen – in Freundschaften, in Communities, in politischen Bewegungen.
Kollektive Fürsorge statt romantisches Monopol
Das Alleinsein dagegen erscheint immer noch häufig wie ein Versagen, vor allem, wenn es Frauen jenseits der 27 trifft. Der Wert eines Menschen scheint erst dann gesichert, wenn er im sozialen Gefüge „wirksam“ wird, also sichtbar auf und durch jemanden. Eine fest definierte Paarbeziehung verspricht genau das: eine Wirkung zu haben. Aber diese Wirkung kann auch anders entstehen, jenseits von romantischen Zweierkonstellationen.
Das hier soll kein Plädoyer für Einsamkeit sein. Menschen sind soziale Wesen. Aber es braucht keine romantische Vorstellung eines fehlenden Puzzlestücks, um Verbindungen zu spüren – zu anderen und zu sich selbst.
nach swipe kommt Sehnsucht
Seit ich wieder date, begegnen mir die kuriosesten interpersonellen Verbindungsversuche. Wenn ich die nicht aufschreibe, glaubt mir das einfach niemand.
Dating-Apps erlauben es ja inzwischen sehr genau anzugeben, wonach man sucht: etwas Lockeres, ethische Nicht-Monogamie, eine feste Beziehung oder Intimität ohne Commitment. Ich bin dieser Idee auf der Spur, aber: ist das noch Ich-Suche oder eine strategische Schadensprophylaxe, um potenzielle Enttäuschungen abzuwenden?

Während ich mich frage, ob Dating-Apps wirklich diese Sehnsüchte in all ihre ehrlichen Einzelteile zerlegen können oder eine präventive Maßnahme gegen Kummer fördern, entdecke ich durch meine Begegnungen neue Dimensionen der Suche nach wie auch immer gearteteter Nähe.
Wie zum Beispiel beim BDSM-Telefonsex mit einem Familienvater, den ich noch nie in der analogen Welt getroffen habe. Uns trennen 445 Kilometer und noch größere Welten, und trotzdem haben wir seit ein paar Wochen regelmäßigen Telefon- und seit Neuestem auch Camsex. Bevor wir uns auf Bumble gematcht haben, hatte ich noch nie Telefonsex für meinen eigenen pleasure, meine BDSM-Erfahrungen ließen sich bis dahin auf soft choking und Augenverbinden reduzieren. Aber ich lasse mich darauf ein und merke: Intimität braucht keine physische Nähe, um tief zu gehen.
Diese Erfahrung öffnet Räume, in denen Rollen und Identitäten fließend bleiben. Sie wirft die Frage auf: Wie formen digitale Räume und alternative Beziehungsmodelle unsere Suche nach Nähe? Und wie verschiebt eine Distanz, die physisch trennt, die Logik der Fürsorge? Denn wenn Nähe nicht an Co-Präsenz gebunden ist, dann entstehen auch neue Möglichkeiten, Verantwortung, Lust und Care anders zu verhandeln.
Gossenpony als forschungsraum
Diese Erkenntnisse haben mich hierher geführt, zu diesem Blog. Vielleicht ist es die denkbar beschissenste Zeit für ein Format, das gegen die Aufmerksamkeitsökonomie läuft. Aber für mich ist das Feldforschung. Ich channele meine innere Carrie Bradshaw, nur eben mit politischem Blick: Sex and the City aka Intimität ohne Commitment im digitalen Zeitalter.
Singlesein, Verbindungen, Intimität, all das sind nicht nur private Geschichten. Sie sind Teil größerer Fragen: Wie sorgen wir füreinander jenseits klassischer Paarmodelle? Welche Räume brauchen wir für Lust, Nähe und Fürsorge? Und was bedeutet es, wenn Fürsorge plötzlich digital, verteilt und fluide wird?
Gossenpony soll genau hier ansetzen.
Darauf erstmal eine Zigarette

Hinterlasse einen Kommentar